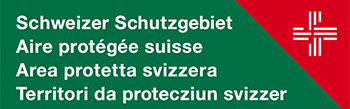Als Orchidee reagiert der Frauenschuh (Cypripedium calciolus) sehr sensibel auf jegliche Veränderung seiner Umgebung. Auch seine Attraktivität ist ihm schon oft zum Verhängnis geworden, denn häufig wurden seine Bestände rücksichtslos geplündert, abgepflückt und ausgegraben. Ausserdem ist die Art sehr sensibel gegenüber Vertritt. Knickt sein spröder Stängel oder bricht gar ab, kann der Frauenschuh in diesem Jahr nicht mehr blühen und ist auch in den nächsten Jahren in seinem Wachstum geschwächt. Auch seine Jungpflanzen sind sehr trittempfindlich.
Die Frauenschuhblüte zieht Jahr für Jahr viele Besucherinnen und Besucher an. Der Lebensraum wird dadurch einer besonderen Belastung ausgesetzt. Ihr umsichtiges Verhalten trägt dazu bei, den Frauenschuh auch nächstes Jahr zu bewundern. Daher bitte:
- Beim Fotografieren auf (Jung-)Pflanzen achten
- Keine Hunde im Frauenschuhgebiet!
Gebietsinformationen

Die dynamische, natürlich fliessende Kander gestaltet ganz wesentlich die einzigartige Landschaft der Aue. Hier findet der Fluss Raum, um sich zu verzweigen, seinen Lauf zu ändern, Kiesbänke aufzuschütten und bei Hochwasser wieder zu erodieren sowie in Breite und Tiefe stark zu variieren. Daneben sorgen auch Hangschutt und Seitenbäche dafür, dass laufend Pionierflächen geschaffen werden. Auf ihnen bilden sich Kraut- und Waldgesellschaften in verschiedenen Sukzessionsstadien aus.
Sehenswertes
Wo er vorkommt, ist es nass. Der Winter-Schachtelhalm (Equisetum hyemale) ist ein Wasserzugzeiger. In feuchten Erlenwäldern lässt er sich oft flächig entdecken. Im Gegensatz zum Acker-Schachtelhalm besteht er aus unverzweigten, astlosen Röhren, die über einen Meter hoch werden können. Der Winter-Schachtelhalm enthält Kieselsäure, weshalb er als Heilmittel zur Stärkung von Bindegewebe und Knochen oder zur Linderung von Harnwegsbeschwerden dient. Er wirkt aber nicht nur innerlich reinigend: Früher wurden damit zinnerne Kochtöpfe und Trinkbecher gescheuert – daher auch der Name «Zinnkraut».

Mit ihren blauvioletten, bis 4 cm grossen, nickenden Blüten gehört die Alpen-Waldrebe (Clematis alpina) zu den auffälligsten Bewohnerinnen der Bergwälder in der Schweiz. Für Bienen, Wespen und Schmetterlinge ist das Hahnenfussgewächs eine wichtige Nektarquelle. Wie eine Liane klettert sie an Bäumen und Sträuchern bis 2 m hoch oder überwächst Felsen. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Gemeinen Waldrebe, umgangssprachlich auch ‹Niele› genannt, gibt es im Kanton Bern aktuell lediglich zwei bekannte Standorte der Alpen-Waldrebe.

Kaum ein anderer Baum kommt so gut mit nassem Boden zurecht wie die Grau-Erle (Alnus incana). Diese wächst an Gewässern und in Feuchtgebieten – kurzum dort, wo es den meisten anderen Baumarten zu nass ist. Die Grau-Erle, auch Weiss-Erle genannt, gehört zur Familie der Birkengewächse. Deren Verarbeitung im Aussenbereich ist ungünstig, da das Holz weder Harz noch Gerbstoffe enthält und zu weich ist. Hingegen eignet sich die Grau-Erle ganz hervorragend für den Pfahlbau. Ihr ist der Erhalt von unermesslichem Kulturgut zu verdanken: Zusammen mit der Eiche stützt sie halb Amsterdam und Venedig.
Seinen Namen erhielt der Admiral (Vanessa atalanta) aufgrund seiner speziellen Flügelfärbung. Seine schwarzen, weiss gefleckten und rot gebänderten Flügel, erinnern an eine Uniform. Ursprünglich flog der Admiral als Wanderfalter jeweils im Frühjahr aus dem Mittelmeerraum über die Alpen nach Mitteleuropa. Hier pflanzte er sich fort und zog im Herbst zur Überwinterung wieder zurück in den Süden. Aufgrund der Klimaerwärmung wird er aber seit der Jahrtausendwende in Mitteleuropa zunehmend sesshaft. Seine Raupen ernähren sich ausschliesslich von der Grossen Brennnessel.

Zwischen Grau-Erlen, Silber-Weiden und anderen Gehölzen entlang von Bächen und Flüssen lagern sich nach Unwettern oft grosse Mengen an Sand, Kies und Schlamm ab. Was den Anschein einer Katastrophe hat, ist in Wirklichkeit das Resultat eines lebendigen Gewässers – also eigentlich ein Gütezeichen! Trotz der zerstörerischen Kraft eines Hochwassers entstehen dabei immer auch neue Lebensräume für zahlreiche Tier-und Pflanzenarten: Offene Stellen für sonnenhungrige Eidechsen, flache Pfützen für Frösche und Molche oder schnell fliessende Bachabschnitte für Wasserinsekten und Bachforellen.

Regeln im Naturschutzgebiet
Im Schutzgebiet ist u.a. untersagt
- das Befahren der Wege mit Motorfahrzeugen (einschliesslich Motorfahrräder) ausgenommen die Zufahrtsstrasse bis zum Parkplatz beim Waldhaus und des Winterwegs bei gesperrter Gasternstrasse. Das Fahrradfahren auf entsprechend markierten Wegen ist erlaubt.
- das Parkieren von Motorfahrzeugen ausserhalb der markierten Park- und Abstellplätze
- das Anzünden von Feuern in unmittelbarer Nähe von Bäumen und Sträuchern
- das Sammeln von Beeren, Moosen, Pilzen und Flechten